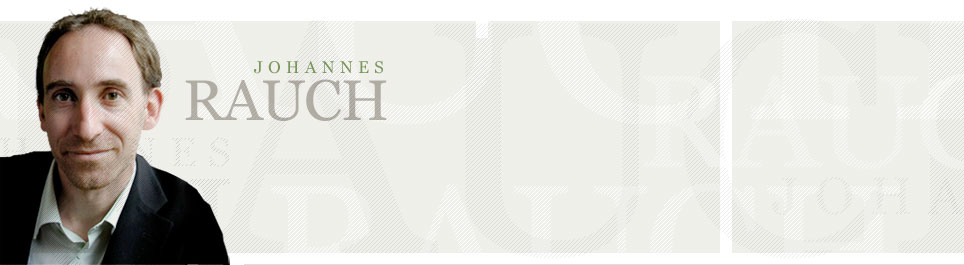Zu früh erwachsen, lebensang infantilisiert
Konrad Paul Liessmann und Jochen Hörisch diskutierten gestern im Theater am Saumarkt zum Thema "Bildungskrise". Spannende Debatte, in der wieder einmal klar wurde, dass zwischen Information, Wissen und Bildung gravierende Unterschiede bestehen, an deren Beseitigung die so genannte "Wissensgesellschaft" deshalb so verbissen arbeitet, weil der Aneignungsprozess bei der Bildung Mühe erfordert, die öknomische Verwertbarkeit aber auf sich warten lässt. Bei Information und kurzfristig akkumulierbarem Wissen verhält es sich genau umgekehrt.
Einen Nebensatz von Jochen Hörisch möchte ich sinngemäss wiedergeben, weil, wie mir scheint, es sich lohnt, darüber nachzudenken:
Wir seien konfrontiert mit dem Phänomen, so Hörisch, dass Kinder immer früher erwachsen sein müssen, weil genormte Vorgaben innerhalb des Bildungssystems dies verlangen - wie zum Beispiel die frühe Entscheidung über Schultypenwahl nach der Volksschule. Leistungsdruck dringe immer weiter vor in die jungen und jüngsten Lebensjahre der Kindheit. Aus Kindern würden auf Leistung gedrillte Klein-Erwachsene gemacht.
Gleichzeitig, stellte Hörisch fest, sehe er eine sich immer mehr verfestigende "lebenslange Infantilisierung" ab dem jungen Erwachsenenalter. Anstatt, zum Beispiel auf der Universität, Verantwortung für sein Studium selbst zu übernehmen, würden durch das neue Bachelor-Master-System Vorgaben gemacht, die genau das verhindern würden.
Diese Infantilisierung fände ihren Ausdruck auch in der medialen Öffentlichkeit, wo unter dem Deckmantel der Information vor allem Unterhaltung geboten werde; eigenständiges Denken und das Herstellen von Zusammenhängen sei weder notwendig noch gewünscht. So Hönisch.
(Ich habe das an anderer Stelle hier schon als "fortschreitende Ramba-Zamba-Verblödung" beschrieben.)
Was das Verschwinden der Kindheit angeht, habe ich mich dann allerdings an Philippe Aries ("Die Geschichte der Kindheit") erinnert, der penibel nachgewiesen hat, dass Kindheit im Laufe der Geschichte immer schon ein rasch vorübergehender Zwischenschritt zum Erwachsensein gewesen ist - das galt für Bauernkinder ebenso wie für Königskinder.
Was mich dann wiederum dazu bringt, dem was in der Kindheit - und hier vor allem in der Schule! - geschieht einen hohen Stellenwert einzuräumen, aber verstärkt zu hinterfragen, was es denn auf sich hat, mit den anschließend einsetzenden Infantilisierungstendenzen. Wem es nützt, zum Beispiel, wenn das Volk durchschnittlich gebildet, unterdurchschnittlich interessiert an den sozialen, politischen und ungleichen öknomischen Verhältnissen aber heftig bemüht um die Optimierung des Faktors "Unterhaltung" ist. (Wobei Unterhaltung nicht mehr heißt, sich mit jemandem zu unterhalten, also zu reden, weil dies meistenorts aufgrund des Lärmpegels unmöglich ist, sondern zu "shoppen", zu "zappen" oder sich vollaufen zu lassen).
Jene vermutlich, die im Sinne von Gerfried Sperl (STANDARD von heute) hoffen, dass "anything goes" die handfeste Umsetzung des Thatcher-Prgrammes "There is no alternative" ist.
Einen Nebensatz von Jochen Hörisch möchte ich sinngemäss wiedergeben, weil, wie mir scheint, es sich lohnt, darüber nachzudenken:
Wir seien konfrontiert mit dem Phänomen, so Hörisch, dass Kinder immer früher erwachsen sein müssen, weil genormte Vorgaben innerhalb des Bildungssystems dies verlangen - wie zum Beispiel die frühe Entscheidung über Schultypenwahl nach der Volksschule. Leistungsdruck dringe immer weiter vor in die jungen und jüngsten Lebensjahre der Kindheit. Aus Kindern würden auf Leistung gedrillte Klein-Erwachsene gemacht.
Gleichzeitig, stellte Hörisch fest, sehe er eine sich immer mehr verfestigende "lebenslange Infantilisierung" ab dem jungen Erwachsenenalter. Anstatt, zum Beispiel auf der Universität, Verantwortung für sein Studium selbst zu übernehmen, würden durch das neue Bachelor-Master-System Vorgaben gemacht, die genau das verhindern würden.
Diese Infantilisierung fände ihren Ausdruck auch in der medialen Öffentlichkeit, wo unter dem Deckmantel der Information vor allem Unterhaltung geboten werde; eigenständiges Denken und das Herstellen von Zusammenhängen sei weder notwendig noch gewünscht. So Hönisch.
(Ich habe das an anderer Stelle hier schon als "fortschreitende Ramba-Zamba-Verblödung" beschrieben.)
Was das Verschwinden der Kindheit angeht, habe ich mich dann allerdings an Philippe Aries ("Die Geschichte der Kindheit") erinnert, der penibel nachgewiesen hat, dass Kindheit im Laufe der Geschichte immer schon ein rasch vorübergehender Zwischenschritt zum Erwachsensein gewesen ist - das galt für Bauernkinder ebenso wie für Königskinder.
Was mich dann wiederum dazu bringt, dem was in der Kindheit - und hier vor allem in der Schule! - geschieht einen hohen Stellenwert einzuräumen, aber verstärkt zu hinterfragen, was es denn auf sich hat, mit den anschließend einsetzenden Infantilisierungstendenzen. Wem es nützt, zum Beispiel, wenn das Volk durchschnittlich gebildet, unterdurchschnittlich interessiert an den sozialen, politischen und ungleichen öknomischen Verhältnissen aber heftig bemüht um die Optimierung des Faktors "Unterhaltung" ist. (Wobei Unterhaltung nicht mehr heißt, sich mit jemandem zu unterhalten, also zu reden, weil dies meistenorts aufgrund des Lärmpegels unmöglich ist, sondern zu "shoppen", zu "zappen" oder sich vollaufen zu lassen).
Jene vermutlich, die im Sinne von Gerfried Sperl (STANDARD von heute) hoffen, dass "anything goes" die handfeste Umsetzung des Thatcher-Prgrammes "There is no alternative" ist.
rauch - 17. Feb, 11:12