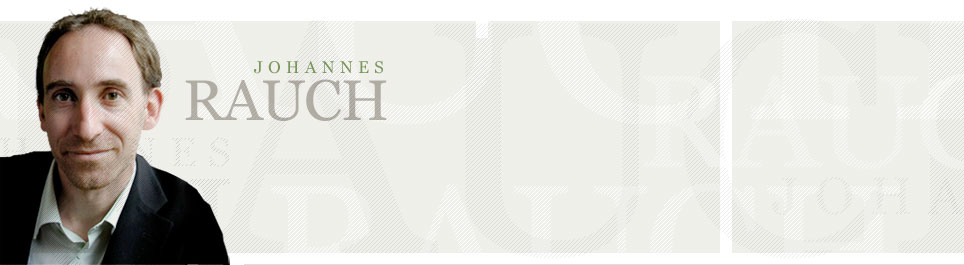Alle Transaktionen besteuern, alle andern Steuern abschaffen?
Edgar L. Feige, gebürtiger Berliner, emigriert in die USA, dort Wirtschaftswissenschaftler u.a. an der University of Wisconsin wirbt für ein Steuerkonzept , das diejenigen zur Kasse bittet, die Geld bewegen. "Normale" Steuern würde er alle abschaffen.
Verrückt?
Hier lesen:
Transaktionssteuern-auf-alles_E-Feige (pdf, 1,763 KB)
Und sonst? Des Finanzministers Budget, vor zwei Wochen vorgestellt, ist bereits Makulatur, weil die Wirtschaft nicht um seine schöngeredeten 2,5% sondern um mindestens (immer noch schöngeredete) 4% schrumpfen und die Staatseinnahmen dahinschmelzen, die Ausgaben hingegen sich auftürmen lässt. Interessieren tut das hierzulande keinen, weil a) JournalistInnen sich die Mühe nicht antun die Budgetbegleitgesetze zu lesen, geschweige denn b) zu hinterfragen, was ihnen so im internationalen Kontext präsentiert wird. Anders formuliert: wir werden angelogen nach Strich und Faden und lassen uns das widerspruchslos gefallen. Als sei man im Kino und schaue sich einen Film an, in dem die Welt von Krise zu Krise taumelt. Der fundamentale Irrtum besteht darin, zu glauben, man sei nur Zuschauer. Tatsächlich ist man Akteur, Teil der realen Handlung und mittendrin statt nur dabei.
Wenig bis gar keine Phantasie wird darauf verwendet, was "nachher" kommt oder kommen könnte oder kommen sollte.
"Der ökonomisch haltlos gewordene Bürger sucht Sicherheit beim starken Mann, im Blut (auch wenn es vergossen wird), im Boden (auch wenn er nicht verteilt wird)," schrieb Bloch.
1938 wohlgemerkt.
Verrückt?
Hier lesen:
Transaktionssteuern-auf-alles_E-Feige (pdf, 1,763 KB)
Und sonst? Des Finanzministers Budget, vor zwei Wochen vorgestellt, ist bereits Makulatur, weil die Wirtschaft nicht um seine schöngeredeten 2,5% sondern um mindestens (immer noch schöngeredete) 4% schrumpfen und die Staatseinnahmen dahinschmelzen, die Ausgaben hingegen sich auftürmen lässt. Interessieren tut das hierzulande keinen, weil a) JournalistInnen sich die Mühe nicht antun die Budgetbegleitgesetze zu lesen, geschweige denn b) zu hinterfragen, was ihnen so im internationalen Kontext präsentiert wird. Anders formuliert: wir werden angelogen nach Strich und Faden und lassen uns das widerspruchslos gefallen. Als sei man im Kino und schaue sich einen Film an, in dem die Welt von Krise zu Krise taumelt. Der fundamentale Irrtum besteht darin, zu glauben, man sei nur Zuschauer. Tatsächlich ist man Akteur, Teil der realen Handlung und mittendrin statt nur dabei.
Wenig bis gar keine Phantasie wird darauf verwendet, was "nachher" kommt oder kommen könnte oder kommen sollte.
"Der ökonomisch haltlos gewordene Bürger sucht Sicherheit beim starken Mann, im Blut (auch wenn es vergossen wird), im Boden (auch wenn er nicht verteilt wird)," schrieb Bloch.
1938 wohlgemerkt.
rauch - 6. Mai, 15:01
Meningitis in Westafrika
Alle reden über die Schweinegrippe, kein Mensch darüber, dass in Westafrika gerade Hunderte an Meningitis und Masern sterben.
Ärzte ohne Grenzen versucht , ein Impfprogramm zu organisieren. Fatal dabei ist, dass die Bedenken der Menschen in der Region, sich impfen zu lassen groß sind: 1996, während der letzten großen Epidemie, testete der US-Pharmakonzern Pfizer in der nordnigerianischen Stadt Kano ein neues Meningitismedikament namens Trovan an knapp 200 Kindern - 11 starben.
Bericht aus der TAZ zum download hier: Meningitis-Westafrika_TAZ (pdf, 25 KB)
Ärzte ohne Grenzen versucht , ein Impfprogramm zu organisieren. Fatal dabei ist, dass die Bedenken der Menschen in der Region, sich impfen zu lassen groß sind: 1996, während der letzten großen Epidemie, testete der US-Pharmakonzern Pfizer in der nordnigerianischen Stadt Kano ein neues Meningitismedikament namens Trovan an knapp 200 Kindern - 11 starben.
Bericht aus der TAZ zum download hier: Meningitis-Westafrika_TAZ (pdf, 25 KB)
rauch - 4. Mai, 21:44
"Hast du meine Alpen gesehen?"
Weil´s gerade passt und ich sie heute gesehen habe, die Alpen, ein Hinweis auf die aktuelle Ausstellung im Jüdischen Museum Hohenems . "Hast du meine Alpen gesehen?" Eine jüdische Beziehungsgeschichte...
Unbedingt besuchen! Unbedingt Ausstellungskatalog erwerben!

(Namenlose Route am Brüggeler, Kanton Glarus/CH)
Unbedingt besuchen! Unbedingt Ausstellungskatalog erwerben!

(Namenlose Route am Brüggeler, Kanton Glarus/CH)
rauch - 3. Mai, 20:25
Alles wird gut!
barry eichengreen, seines zeichens doch recht renommierter ökonom in berkeley, hat den zen buddhismus für sich (und uns) entdeckt und konfrontiert uns mit gedankenrätseln von zeitloser eleganz!
zusammenfassung für den eiligen leser:
* empirische (!) value-at-risk-modelle haben, aufgrund der datenlage, aber auch aufgrund von fehlinterpretation und (intellektueller) faulheit, erheblich zum entstehen der aktuellen finanz- und wirtschaftskrise beigetragen
* die ökonomischen theorien waren/sind nicht falsch, allerdings haben die adressaten rosinen gepickt und haben nur das gehört, was sie hören wollten
* viele (akademische) ökonomen haben sich kaufen lassen, etwa durch vortragshonorare, und erzählt, was ihre kunden hören wollten. nonkonformisten wurden an den rand gedrängt.
* die ökonomische theorie hat sich als so "dehnbar" erwiesen, dass mit den darauf aufbauenden modellen praktisch jedes beliebige ergebnis erzielt werden konnte
* jetzt wird aber alles besser, denn jetzt kommt aber die große zeit der empirischen (!) ökonomie, die z.b. belegt hat, dass an sonnentagen die aktien eher steigen (in your face, ihr blinden verfechter der theorie der effizienten märkte). ---> an dieser stelle bitte wieder an den ersten punkt springen!
wer die (scheinbaren) widersprüche dieser argumentation meditativ überwindet, dem ist der übergang ins nirvana praktisch nicht mehr zu nehmen!
kompletter text hier.
(Dank für diesen Hinweis an Gerhard und Romana)
zusammenfassung für den eiligen leser:
* empirische (!) value-at-risk-modelle haben, aufgrund der datenlage, aber auch aufgrund von fehlinterpretation und (intellektueller) faulheit, erheblich zum entstehen der aktuellen finanz- und wirtschaftskrise beigetragen
* die ökonomischen theorien waren/sind nicht falsch, allerdings haben die adressaten rosinen gepickt und haben nur das gehört, was sie hören wollten
* viele (akademische) ökonomen haben sich kaufen lassen, etwa durch vortragshonorare, und erzählt, was ihre kunden hören wollten. nonkonformisten wurden an den rand gedrängt.
* die ökonomische theorie hat sich als so "dehnbar" erwiesen, dass mit den darauf aufbauenden modellen praktisch jedes beliebige ergebnis erzielt werden konnte
* jetzt wird aber alles besser, denn jetzt kommt aber die große zeit der empirischen (!) ökonomie, die z.b. belegt hat, dass an sonnentagen die aktien eher steigen (in your face, ihr blinden verfechter der theorie der effizienten märkte). ---> an dieser stelle bitte wieder an den ersten punkt springen!
wer die (scheinbaren) widersprüche dieser argumentation meditativ überwindet, dem ist der übergang ins nirvana praktisch nicht mehr zu nehmen!
kompletter text hier.
(Dank für diesen Hinweis an Gerhard und Romana)
rauch - 1. Mai, 10:59
Vermögenssteuern: Aber sicher!
ACHTUNG! WEITERLESEN!
Hier kommt nicht meine Meinung, sondern jene eines ausgewiesenen ÖVP-Mitglieds und Spitzenfunktionärs in der Arbeiterkammer Vorarlberg - und die ist mit absoluter Mehrheit schwarz, zur Information an LeserInnen aus dem Osten Österreichs. Also:
"Alles bleibt wie es ist"
von Rainer Keckeis, AK-Direktor
Wählerverdummung zählt nicht selten zu den Prinzipien parteipolitischer Kommunikation, jüngst wieder schön an der Diskussion über Vermögenssteuern zu sehen. Zuerst führt die SPÖ unter Finanzminister Lacina ein Stiftungsrecht ein, das vermögenden Privatpersonen eine steuerschonende Möglichkeit bietet, ihr Hab und Gut vor den lieben Verwandten, aber auch vor dem Staat in Sicherheit zu bringen.
Nachdem die wirklich Vermögenden dies getan haben, kommt nun seltsamerweise gerade diese Partei auf die Idee, Vermögenssteuern einzuführen. Reflexartig natürlich die Ablehnung durch den Koalitionspartner ÖVP mit dem Hinweis, niemand wolle neue Steuern. Argumentiert wird, wie so oft, mit dem kleinen Hausbesitzer, dessen Vermögenswerte es zu schonen gilt. Wohlwissend, dass praktisch alle seriösen Vorschläge zu einer Vermögensbesteuerung große Freibeträge vorsehen, damit die so genannte Mittelschicht mit einem Vermögen bis rund 500.000 Euro keine Steuer zahlen müsste. Seltsam mutet bei einer näheren Betrachtung an, dass die nicht zuletzt unter der SPÖ/ÖVP-Regierung horrend angestiegenen Staatsschulden aber genau vom Mittelstand zurückzuzahlen sind, weil große Vermögen steuerfrei bleiben müssen. Steuerzahler bleiben also großteils die Arbeitnehmer über die Lohn- sowie die Konsumenten über die Umsatzsteuer. Diese beiden Positionen machen fast zwei Drittel der Steuereinnahmen des Bundes aus. Den Luxus auf Verzicht einer vernünftigen Vermögenssteuer leisten sich nur wenige Industrieländer. Typisch österreichisch lässt Bundeskanzler Faymann die Diskussion seiner SPÖ-Parteifreunde über eine Vermögenssteuer zu. Wenig überraschend bewegt er sich aber in der Sache selbst nicht. Sowohl sein Herausgeberfreund als auch sein Koalitionspartner lassen ihn sicher nicht lange Bundeskanzler spielen, sollte er wirklich auf die Idee kommen, die Millionenvermögen der Reichen anzutasten. Deshalb wird wohl alles bleiben, wie es ist, und die Frage der Verteilungsgerechtigkeit weiterhin zum leichtfertigen Spielball der Parteien, den sie in die Menge werfen, wenn ihnen aus wahltaktischen Gründen danach ist.
rainer.keckeis@ak-vorarlberg.at
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Hier kommt nicht meine Meinung, sondern jene eines ausgewiesenen ÖVP-Mitglieds und Spitzenfunktionärs in der Arbeiterkammer Vorarlberg - und die ist mit absoluter Mehrheit schwarz, zur Information an LeserInnen aus dem Osten Österreichs. Also:
"Alles bleibt wie es ist"
von Rainer Keckeis, AK-Direktor
Wählerverdummung zählt nicht selten zu den Prinzipien parteipolitischer Kommunikation, jüngst wieder schön an der Diskussion über Vermögenssteuern zu sehen. Zuerst führt die SPÖ unter Finanzminister Lacina ein Stiftungsrecht ein, das vermögenden Privatpersonen eine steuerschonende Möglichkeit bietet, ihr Hab und Gut vor den lieben Verwandten, aber auch vor dem Staat in Sicherheit zu bringen.
Nachdem die wirklich Vermögenden dies getan haben, kommt nun seltsamerweise gerade diese Partei auf die Idee, Vermögenssteuern einzuführen. Reflexartig natürlich die Ablehnung durch den Koalitionspartner ÖVP mit dem Hinweis, niemand wolle neue Steuern. Argumentiert wird, wie so oft, mit dem kleinen Hausbesitzer, dessen Vermögenswerte es zu schonen gilt. Wohlwissend, dass praktisch alle seriösen Vorschläge zu einer Vermögensbesteuerung große Freibeträge vorsehen, damit die so genannte Mittelschicht mit einem Vermögen bis rund 500.000 Euro keine Steuer zahlen müsste. Seltsam mutet bei einer näheren Betrachtung an, dass die nicht zuletzt unter der SPÖ/ÖVP-Regierung horrend angestiegenen Staatsschulden aber genau vom Mittelstand zurückzuzahlen sind, weil große Vermögen steuerfrei bleiben müssen. Steuerzahler bleiben also großteils die Arbeitnehmer über die Lohn- sowie die Konsumenten über die Umsatzsteuer. Diese beiden Positionen machen fast zwei Drittel der Steuereinnahmen des Bundes aus. Den Luxus auf Verzicht einer vernünftigen Vermögenssteuer leisten sich nur wenige Industrieländer. Typisch österreichisch lässt Bundeskanzler Faymann die Diskussion seiner SPÖ-Parteifreunde über eine Vermögenssteuer zu. Wenig überraschend bewegt er sich aber in der Sache selbst nicht. Sowohl sein Herausgeberfreund als auch sein Koalitionspartner lassen ihn sicher nicht lange Bundeskanzler spielen, sollte er wirklich auf die Idee kommen, die Millionenvermögen der Reichen anzutasten. Deshalb wird wohl alles bleiben, wie es ist, und die Frage der Verteilungsgerechtigkeit weiterhin zum leichtfertigen Spielball der Parteien, den sie in die Menge werfen, wenn ihnen aus wahltaktischen Gründen danach ist.
rainer.keckeis@ak-vorarlberg.at
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
rauch - 28. Apr, 13:36
"Wir haben ja nur ein bisschen gespielt!"....
Ein Bürger dieses Landes berichtet folgendes: Es sei letztens von Schwarzach nach Bildstein gewandert. Plötzlich habe er, nichts böses ahnend, im Wald einige, mit Tarnuniform bekleidete und alle glatzköpfig daherkommende Personen beobachtet , die dort so eine Art Paintballmatch durchgeführt hätten. Als er daraufhin bei der Gendarmerie Wolfurt angerufen habe, erfuhr er, dass das bekannt und mit dem dortigen Waldbesitzer abgesprochen sei. Verwundert erzählte er die Begebenheit einem Kollegen - der sich, weil ein anderes Gemüt, darüber wesentlich mehr empörte. Auch er rief bei der Polizei an. Dort war man nicht sehr hilsfbereit und wusste zuerst von garnichts.
Erst als er nocheinmal nachhakte und erwähnte, dass ihm bekannt sei, dass dies schon schon gemeldet wurde, wusste man doch plötzlich etwas. Es handle sich dabei um ein ganz normales Paintballspiel im Wald, durchgeführt von einem angemeldeten Verein. Welcher Verein sei nicht bekannt. "Das sei schließlich etwas ganz normales" wurde noch mitgeteilt und anschließend nach dem Namen gefragt und warum mich man sich dafür interessiere....
Der Verdacht, dass die dort "spielenden" Personen der Skinheadszene angehören drängt sich auf. Man (in diesem Fall: ich) wird die Sicherheitsdirektion fragen, was es damit auf sich hat. Weil dort ja immer amtswegig beschieden wird, man habe die Szene "im Griff" und würde im übrigen "genau beobachten".
Erst als er nocheinmal nachhakte und erwähnte, dass ihm bekannt sei, dass dies schon schon gemeldet wurde, wusste man doch plötzlich etwas. Es handle sich dabei um ein ganz normales Paintballspiel im Wald, durchgeführt von einem angemeldeten Verein. Welcher Verein sei nicht bekannt. "Das sei schließlich etwas ganz normales" wurde noch mitgeteilt und anschließend nach dem Namen gefragt und warum mich man sich dafür interessiere....
Der Verdacht, dass die dort "spielenden" Personen der Skinheadszene angehören drängt sich auf. Man (in diesem Fall: ich) wird die Sicherheitsdirektion fragen, was es damit auf sich hat. Weil dort ja immer amtswegig beschieden wird, man habe die Szene "im Griff" und würde im übrigen "genau beobachten".
rauch - 27. Apr, 19:33
Tage der Utopie 4
Ilija Trojanow ist allein schon aufgrund seiner Biographie (geboren in Sofia, lebte er u.a. in Kenia, Indien, Deutschland und derzeit in Wien) mehr als befugt, über das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen zu reden. Das tat er am Donnerstag in Arbogast.
"Kulturen bekämpfen sich nicht, Kulturen fließen zusammen" lautet seine "Kampfabsage". Europa habe sich nicht vor "Überfremdung" zu fürchten, sondern vielmehr vor einem Mangel an "Fremden": Kulturen, die danach trachteten, sich abzuschotten und alles Andere, Fremde draußen zu halten sind stets verödet. Trojanow führte mit großem historischem Wissen und zahlreichen Belegen den Beweis. Im anderen den Fremden, den Gegensatz zu sehen trägt den Keim des Konfliktes in sich. Wenn das Fremde (der Fremde) zum Gegner wird, ist der Krieg nicht weit. Nur aus dem Zusammenfluß unterschiedlicher Kulturen erwächst Neues und Innovatives.
Beispiel Alexandria: "Als Kreuzungspunkt vieler Handelswege, die Asien, Europa und Afrika berbanden, beherbergte Alexandria griechische Philosophen, jüdische gelehrte und indische Yogis. Euklid verfasste dort seine Abhandlungen über die Geometrie und 72 hellenisierte Juden schufen die Septuaginta, die erste griechisches Übersetzung des Alten Testaments." (Trojanow).
Das Zusammenfließen der der Kulturen ist, so Trojanow, ist beileibe nicht immer ein friedlicher Prozess gewesen, bei dem das Andere mit offenen Armen aufgenommen wurde.
Ich fand den Abend einen gelungenen Einstieg in die Lektüre des Buches "Kampfabsage. Kulturen bekämpfen sich nicht - sie fließen zusammen."
Das habe ich mir nämlich gleich am nächsten Tag bestellt...
Am Freitag konnte ich leider nicht mehr dabei sein.
Alle Referate sind als podcasts zum download vorhanden - hier nämlich.
Fazit der vier Tage, an denen ich dabei war: viel Inspiration, viel Anregung und große Lust, manches weiterzudenken.
Wer gar nicht dabei war, möge sich auf jeden Fall und unbedingt die CD mit den Musikbeiträgen von Courvoisier und Feldman besorgen. Erscheint in etwa drei Monaten.
Die Referate konnte ich in aller Knappheit schildern, die Musik leider nicht...
"Kulturen bekämpfen sich nicht, Kulturen fließen zusammen" lautet seine "Kampfabsage". Europa habe sich nicht vor "Überfremdung" zu fürchten, sondern vielmehr vor einem Mangel an "Fremden": Kulturen, die danach trachteten, sich abzuschotten und alles Andere, Fremde draußen zu halten sind stets verödet. Trojanow führte mit großem historischem Wissen und zahlreichen Belegen den Beweis. Im anderen den Fremden, den Gegensatz zu sehen trägt den Keim des Konfliktes in sich. Wenn das Fremde (der Fremde) zum Gegner wird, ist der Krieg nicht weit. Nur aus dem Zusammenfluß unterschiedlicher Kulturen erwächst Neues und Innovatives.
Beispiel Alexandria: "Als Kreuzungspunkt vieler Handelswege, die Asien, Europa und Afrika berbanden, beherbergte Alexandria griechische Philosophen, jüdische gelehrte und indische Yogis. Euklid verfasste dort seine Abhandlungen über die Geometrie und 72 hellenisierte Juden schufen die Septuaginta, die erste griechisches Übersetzung des Alten Testaments." (Trojanow).
Das Zusammenfließen der der Kulturen ist, so Trojanow, ist beileibe nicht immer ein friedlicher Prozess gewesen, bei dem das Andere mit offenen Armen aufgenommen wurde.
Ich fand den Abend einen gelungenen Einstieg in die Lektüre des Buches "Kampfabsage. Kulturen bekämpfen sich nicht - sie fließen zusammen."
Das habe ich mir nämlich gleich am nächsten Tag bestellt...
Am Freitag konnte ich leider nicht mehr dabei sein.
Alle Referate sind als podcasts zum download vorhanden - hier nämlich.
Fazit der vier Tage, an denen ich dabei war: viel Inspiration, viel Anregung und große Lust, manches weiterzudenken.
Wer gar nicht dabei war, möge sich auf jeden Fall und unbedingt die CD mit den Musikbeiträgen von Courvoisier und Feldman besorgen. Erscheint in etwa drei Monaten.
Die Referate konnte ich in aller Knappheit schildern, die Musik leider nicht...
rauch - 25. Apr, 21:02
Tage der Utopie 3 - Die Tafelrunde
Vom Patriarchat zur Tafelrunde – Die Utopie der „erleuchteten“ Organisation. Referent: Herbert Salzmann.
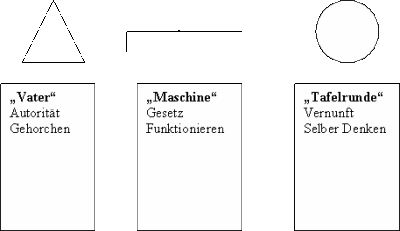
Nicht schwer zu erraten: die Organisationsformen "Vater" und "Maschine" sind für Salzmann überholt. Schnee von gestern.
Der Organisationstypus "Vater" steht für autoritäre Führung, beherrschen und ist höchstens eine Pionierkultur.
Der Organisationstypus "Maschine" kam verstärkt auf mit der Erfindung der Dampfmaschine und der Mechanisieurng unseres Denkens. Die meisten großen Organisationsformen funktionieren nach diesem Prinzip.
Der Komplexität unserer Zeit angemessen sei, so Salzmann, der Organisationstypus "Tafelrunde" - wobei die als Bild zu verstehen ist.
Im Zentrum steht dort die "Vernunft" - im Sinne und hergeleitet von "vernehmen", also der Fähigkeit zum Erfassen geistiger Zusammenhänge.
Salzmann konfrontierte uns weniger mit betriebswirtschaftlich-theoretischen Führungsprinzipien, sondern vielmehr mit der Wahrnehmung von Kunst oder der Improvisationstechnik von Keith Jarret und Sätzen wie "Jugendliche hören auf zu gehorchen, wenn sie vernünftig werden."
Gute Führung sei die Kunst, die Balance zu wahren zwischen Eingreifen und Gewährenlassen.
Unschwer zu erraten, dass die Diagnose von Salzmann war, dass die allermeisten Führenden (in Unternehmen wie in der Politik) davon Lichtjahre entfernt sind.
(Die Dürftigkeit dieser Zusammenfassung wird dem Abend leider nicht gerecht, aber ich habe meine Notizen verloren....)
Zu Person und Schaffen mehr hier.
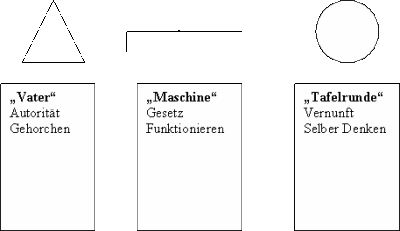
Nicht schwer zu erraten: die Organisationsformen "Vater" und "Maschine" sind für Salzmann überholt. Schnee von gestern.
Der Organisationstypus "Vater" steht für autoritäre Führung, beherrschen und ist höchstens eine Pionierkultur.
Der Organisationstypus "Maschine" kam verstärkt auf mit der Erfindung der Dampfmaschine und der Mechanisieurng unseres Denkens. Die meisten großen Organisationsformen funktionieren nach diesem Prinzip.
Der Komplexität unserer Zeit angemessen sei, so Salzmann, der Organisationstypus "Tafelrunde" - wobei die als Bild zu verstehen ist.
Im Zentrum steht dort die "Vernunft" - im Sinne und hergeleitet von "vernehmen", also der Fähigkeit zum Erfassen geistiger Zusammenhänge.
Salzmann konfrontierte uns weniger mit betriebswirtschaftlich-theoretischen Führungsprinzipien, sondern vielmehr mit der Wahrnehmung von Kunst oder der Improvisationstechnik von Keith Jarret und Sätzen wie "Jugendliche hören auf zu gehorchen, wenn sie vernünftig werden."
Gute Führung sei die Kunst, die Balance zu wahren zwischen Eingreifen und Gewährenlassen.
Unschwer zu erraten, dass die Diagnose von Salzmann war, dass die allermeisten Führenden (in Unternehmen wie in der Politik) davon Lichtjahre entfernt sind.
(Die Dürftigkeit dieser Zusammenfassung wird dem Abend leider nicht gerecht, aber ich habe meine Notizen verloren....)
Zu Person und Schaffen mehr hier.
rauch - 23. Apr, 11:32